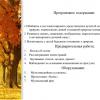Eines der drängenden Probleme der letzten Jahrzehnte im Bereich der Wasseraufbereitung ist die Notwendigkeit, Trinkwasser zu desodorieren. Die Verschlechterung der Geschmackseigenschaften natürlicher Wässer ist auf ihre mineralische und organische Zusammensetzung zurückzuführen. Unerwünschte Geschmäcker und Gerüche werden durch anorganische Verbindungen und organische Stoffe natürlichen und künstlichen Ursprungs verursacht.
Das Vorhandensein gelöster organischer Substanzen biologischen Ursprungs in natürlichen Gewässern ist das Ergebnis von Zersetzungsprozessen und anschließender Umwandlung abgestorbener höherer Wasserpflanzen, planktonischer und benthischer Organismen, verschiedener Bakterien und Pilze. Gleichzeitig werden große Mengen niedermolekularer Alkohole, Carbonsäuren, Hydroxysäuren, Ketone, Aldehyde und phenolhaltige Substanzen mit starkem Geruch in das Wasser abgegeben.
Organische Substanzen tragen zur Entwicklung von Mikroorganismen bei, die Schwefelwasserstoff, Ammoniak, organische Sulfide und übelriechende Mercaptane an die äußere Umgebung abgeben. Die intensive Entwicklung und das Absterben von Algen trägt zum Auftreten von Polysacchariden im Wasser bei; Oxal-, Wein- und Zitronensäure; Substanzen wie Phytonzide. In den Abbauprodukten von Algen liegt der Phenolgehalt 20-30 mal höher als die maximal zulässige Konzentration (0,001 mg/l).
Trotz der ergriffenen gesetzgeberischen Maßnahmen gelangen Industrieabwässer immer noch in Oberflächengewässer, was zu deren Verunreinigung mit mineralischen und organischen Verbindungen führt. Darunter sind Salze von Schwermetallen, Öl und Erdölprodukten, synthetische aliphatische Alkohole, Polyphenole, Säuren, Pestizide, Tenside usw.
Besonders gefährlich sind Pestizide, die zu verschiedenen Klassen organischer Verbindungen gehören und in den Gewässern verschiedener Bundesstaaten vorkommen. Sie wirken sich negativ auf die organoleptischen Eigenschaften von Wasser aus. Die Toxizität der im Wasser vorhandenen Pestizide nimmt zu, wenn es mit Chlor oder Kaliumpermanganat behandelt wird.
Öl und Erdölprodukte sind in Wasser schlecht löslich und sehr resistent gegen biochemische Oxidation. Große Ölkonzentrationen verleihen dem Wasser einen starken Geruch, erhöhen seine Farbe und Oxidationsfähigkeit und verringern den Gehalt an gelöstem Sauerstoff. Bei einem geringen Ölgehalt im Wasser verschlechtern sich seine organoleptischen Eigenschaften merklich.
Wenn Tenside mit Haushalts- und Industrieabwässern ins Wasser gelangen, verschlechtern sie dessen Qualität erheblich und verursachen anhaltende Gerüche (Seife, Kerosin, Kolophonium) und bitteren Geschmack. Tenside erhöhen in der Regel die Geruchsstabilität anderer Verunreinigungen, katalysieren die Toxizität krebserregender Stoffe, Pestizide, Anilin etc. im Wasser.
Huminsäuren und Fulvosäuren, Lignine und viele andere organische Verbindungen natürlichen Ursprungs, die in den natürlichen Gewässern Nord- und Zentralrusslands vorkommen, dienen als eine der Quellen für die Bildung von Phenolen, die ihre organoleptischen Eigenschaften verschlechtern. Bei der Chlorierung von phenolhaltigem Wasser entstehen Dioxine – äußerst giftige Substanzen (tödliche Dosen: Strychnin 1,5-10-6; Botulin - 3,3-10-17, Nervengas - 1,6 · 10-5 mol/kg). Eine Dioxindosis von 3,1-10~9 ist tödlich, und eine Dosis von 6,5-10~15 mol/kg für Menschen unter 70 Jahren birgt das Krebsrisiko. Eine hundertmal geringere Dosis wirkt sich auf das Immunsystem aus System („chemische AIDS“) und Fortpflanzungsfunktionen des Körpers. Die giftigste Substanz ist 2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin (TCDD). Die wichtigste giftige Substanz in Emissionen aus Zellstoff- und Papierfabriken sind polychlorierte Dibenzofurane (PCDF) und Das stärkste Karzinogen – Verbrennungsprodukte von Heizöl, Benzin, Kohle usw. – ist Benzo(a)pyren (Synergie manifestiert sich im Dioxin-Benzo(a)pyren-Paar).
Die Herstellung des Pestizids 2,4-Dichlorphenol durch Chlorierung von Phenol geht mit der Bildung von 2,4,6-Trichlorphenol einher, das selbst zu Dioxinen kondensiert, die den Menschen mit Trinkwasser erreichen, da moderne Wasseraufbereitungstechnologien keine Barriere aufweisen Funktionen gegen Letzteres. Es wurde festgestellt, dass polychloriertes Dibenzo-i-dioxin (PCDD) und polychloriertes Dibenzfuran (PCDF) direkt bei der Chlorierung von Wasser entstehen, d. h. die Bildung von Dixinen bei der Vorchlorierung von Wasser ist unvermeidlich.
Das im Wasser enthaltene Eisen ist ein Katalysator für die zusätzliche Chlorierung von Phenolen und wandelt bei der Wasserchlorierung geringtoxische Dioxine in hochgiftige um. Die im Wasser enthaltenen organischen Substanzen passieren die Beladung der Schnellfilter nahezu ungehindert, einschließlich ihres giftigen dioxinhaltigen Anteils.
Manchmal verschlechtern sich die organoleptischen Eigenschaften von Wasser aufgrund einer Überdosierung von Reagenzien oder aufgrund eines unsachgemäßen Betriebs von Wasseraufbereitungsanlagen. Wenn sich Wasser durch Koagulation ohne anschließende Stabilisierung verfärbt, nimmt die korrosive Aktivität des Wassers zu und infolgedessen verschlechtern sich seine organoleptischen Eigenschaften. Bei der Chlorierung von Wasser kommt es sowohl bei Verstößen gegen das Prozessregime als auch durch die Bildung chlororganischer Verbindungen, die unangenehme Geschmäcker und Gerüche verursachen, zu einer Verschlechterung seiner organoleptischen Eigenschaften.
Es wurde festgestellt, dass herkömmliche Methoden der Wasserreinigung eine schwache Barrierewirkung haben, vor allem gegenüber den im Wasser vorkommenden chemischen Verunreinigungen. Wasser in Form von Suspensionen und Kolloiden oder werden bei der Reinigung und Vorbehandlung mit Chlor unlöslich (z. B. emulgierte Erdölfraktionen, schwerlösliche Pestizide, einige Metalle). In Bezug auf solche Verunreinigungen kann die Barrierefunktion von Aufbereitungsanlagen durch die entsprechende Auswahl von Reagenzien für einen hohen Grad der Wasserklärung erhöht werden.
Die Desodorierung von Wasser wird in einigen Fällen durch Koagulation und Ausflockung von Verunreinigungen und anschließende Filtration erreicht. Oft ist jedoch der Einsatz spezieller Technologien erforderlich, um unerwünschte Gerüche und Geschmäcker zu beseitigen. Ihre Wahl wird durch die Art der Verunreinigungen und den Zustand, in dem sie sich befinden (Suspensionen, Kolloide, echte Lösungen, Gase), bestimmt.
Heutzutage gibt es keine universellen Methoden zur Wasserdesodorierung; die Kombination einiger davon sorgt jedoch für den erforderlichen Reinigungsgrad. Wenn Substanzen, die unangenehme Geschmäcker und Gerüche verursachen, in einem suspendierten und kolloidalen Zustand vorliegen, führt ihre Koagulation zu guten Ergebnissen. Geschmacks- und Geruchsstoffe, die durch gelöste anorganische Stoffe entstehen, werden durch Entgasung, Enteisenung und Entsalzung entfernt. usw. Gerüche und Geschmäcker, die durch organische Substanzen verursacht werden, sind sehr hartnäckig. Sie werden normalerweise entfernt< путем оксидации и сорбции.
Stoffe mit stark reduzierenden Eigenschaften (Huminsäuren, Eisen(II)-Salze, Tannine, Schwefelwasserstoff, Nitrite, mehr- und einwertige Phenole etc.) werden durch Oxidation leicht aus Wasser extrahiert. Stabilere Verbindungen (Carbonsäuren, aliphatische Alkohole, Erdölkohlenwasserstoffe und Erdölprodukte usw.) werden bei Behandlung mit Chlor und seinen Derivaten und manchmal sogar Ozon schlecht oxidiert. Manchmal verstärken starke Oxidationsmittel, die auf diese Substanzen einwirken, den ursprünglichen Geschmack und Geruch erheblich (z. B. Organophosphat-Pestizide). Gleichzeitig führt die Einwirkung von Oxidationsmitteln auf leicht oxidierbare Verbindungen zu deren vollständiger Zerstörung oder zur Bildung von Stoffen, die die organoleptischen Eigenschaften des Wassers nicht beeinträchtigen. Daher ist die Wirkung von Oxidationsmitteln nur gegen eine begrenzte Anzahl von Verunreinigungen wirksam.
Der Nachteil der oxidativen Methode besteht auch darin, dass das Oxidationsmittel sehr genau entsprechend dem Grad und der Art der Wasserverschmutzung dosiert werden muss, was angesichts der Komplexität und Dauer vieler chemischer Analysen äußerst schwierig ist.
Zuverlässiger und wirtschaftlicher ist der Einsatz von Filtern mit körniger Aktivkohle als Filtermedium. Mit körniger Aktivkohle beladene Filter stellen unabhängig von Schwankungen der Wasserverschmutzung eine dauerhafte Barriere gegen sorbierte Stoffe dar. Eine große Schwierigkeit bei der Anwendung dieser Methode der Wasserreinigung ist jedoch die relativ geringe Absorptionsfähigkeit der Kohle, die einen häufigen Austausch oder eine Regeneration erforderlich macht.
Darüber hinaus wurde festgestellt, dass hydrophobe Substanzen durch Aktivkohle gut aus Wasser sorbiert werden, d. h. darin schlecht löslich sind und in Lösungen schlecht hydratisiert werden (schwache organische Elektrolyte, Phenole usw.). Stärkere organische Elektrolyte und viele organische azyklische Verbindungen (Carbonsäuren, Aldehyde, Ketone, Alkohole) werden von Aktivkohle weniger effektiv sorbiert.
Bei erhöhter anthropogener Verschmutzung von Gewässern ist es notwendig, Methoden der Oxidation, Sorption und Belüftung zu kombinieren, um Wasser zu desodorieren und giftige Mikroschadstoffe zu entfernen.
Wasserdesodorierung durch Belüftung
Um flüchtige organische Verbindungen biologischen Ursprungs, die Gerüche und Geschmack verursachen, aus natürlichen Gewässern zu entfernen, wird häufig Belüftung eingesetzt.
In der Praxis erfolgt die Belüftung in speziellen Anlagen – Sprudel-, Sprüh- und Kaskadenbelüftern.
Bei Sprudelbelüftern wird die von Gebläsen zugeführte Luft durch im Tank aufgehängte perforierte Rohre (Abb. 15.1) und am Boden befindliche Sprühvorrichtungen im Wasser verteilt. Der Vorteil der ersten Methode ist die einfache Demontage der Anlage.
Die Luftverteilung durch Zerstäubungsgeräte wird häufig bei Spiralwasserbelüftern eingesetzt, die in Großanlagen eingesetzt werden.
Die Tiefe der Wasserschicht in Belüftern dieses Typs liegt zwischen 2,7 und 4,5 m. Untersuchungen zeigen, dass die Höhe der Wasserschicht während des Sprudelns sofort erreicht wird, da das Gleichgewicht zwischen den Konzentrationen der geruchstragenden Substanzen in der flüssigen und gasförmigen Phase erreicht wird spielt keine wesentliche Rolle und kann auf 1-1,5 m reduziert werden. Die maximale Breite des Beckens beträgt in der Regel das Doppelte der Tiefe. Quadrat

Reis. 15.1. Blasenbelüfter (a) und Inkabelüfter (b)
6 - Hauptluftkanal; 2 – Wassereinlass in die Sprudelkammer 5; 3 - Lochplatten; 4 - Luftverteiler; 7.1 - Ableitung von belüftetem Wasser und Zufuhr von Quellwasser; 8 - Überlauf; 9 - stabilisierte Trennwand; 10 - Schaumschicht; 11 - Ventilator; 12 - perforierter Boden; b – Die Oberflächenblasenkammer wird willkürlich gewählt. Die Dauer des Luftblasens beträgt in der Regel nicht mehr als 15 Minuten. Der Luftverbrauch beträgt 0,37–0,75 m3/min pro 1 m3 Wasser.
Offene Sprudelanlagen können bei Temperaturen unter 0 °C betrieben werden. Der Belüftungsgrad lässt sich einfach durch Veränderung der zugeführten Luftmenge einstellen. Der Aufwand für Installationen und deren Betrieb ist gering.
Bei Sprühbelüftern wird Wasser durch Düsen in kleine Tropfen versprüht und dadurch die Kontaktfläche zur Luft vergrößert. Der Hauptfaktor für den Betrieb des Belüfters ist die Form der Düse und ihre Abmessungen. Die Kontaktdauer von Wasser mit Luft, bestimmt durch die Anfangsgeschwindigkeit des Strahls und seine Flugbahn, beträgt üblicherweise 2 s“ (für einen vertikalen Strahl, der unter einem Druck von 6 m ausgestoßen wird).
Bei Kaskadenbelüftern fällt das behandelte Wasser in Strahlen durch mehrere hintereinander angeordnete Wehre. Die Kontaktdauer kann bei diesen Belüftern durch Erhöhung der Stufenzahl verändert werden. Der Druckverlust bei Kaskadenbelüftern liegt zwischen 0,9 und 3 m.
Bei Mischbelüftern wird Wasser gleichzeitig versprüht und fließt in einem dünnen Strahl von einer Stufe zur anderen. Um die Kontaktfläche zwischen Wasser und Luft zu vergrößern, werden Keramikkugeln oder Koks verwendet.
Ein häufiger Nachteil von Belüftern, die auf dem Prinzip des Kontakts eines Wasserfilms mit Luft basieren, ist ihre Unwirtschaftlichkeit aufgrund ihrer großen Fläche, die Unmöglichkeit, sie im Winter zu verwenden, die Notwendigkeit einer starken Belüftung bei der Installation in Innenräumen und schließlich ihre Neigung zur Verschmutzung.
Die Belüftung des Wassers in der Schaumschicht erfolgt in einem Inka-Belüfter (Abb. 15.1.6), einem Betontank, an dessen Boden sich eine perforierte Edelstahlplatte befindet. Das Wasser wird durch ein Verteilerrohr gleichmäßig über die Platte verteilt. Zur Stabilisierung der Schaumstoffschicht kommt ein spezielles Prallblech zum Einsatz. Das Wasser wird mit Luft belüftet, die von einem Ventilator zugeführt wird. Nachdem das Wasser den Tintenbelüfter passiert hat, wird es über den Überlauf abgeführt.
Die Ausbildung einer riesigen Grenzfläche zwischen flüssiger und gasförmiger Phase sorgt für eine hohe Intensität des Desodorierungsprozesses. Das normale Luft-Wasser-Verhältnis in Farbbelüftern liegt zwischen 30:1 und 300:1. Trotz des hohen Luftverbrauchs ist eine intensive Belüftung wirtschaftlich sinnvoll (aufgrund des geringen Druckverlustes erfolgt die Luftzufuhr über einen Ventilator).
Durch die Belüftung können jedoch anhaltende Gerüche und Geschmäcker nicht beseitigt werden, die durch das Vorhandensein von Verunreinigungen mit unbedeutender Flüchtigkeit verursacht werden.
Liste der verwendeten Arbeiten
Cherkinsky S.N. Sanitäre Bedingungen für die Ableitung von Abwasser in Stauseen, M.: Stroyizdat, Abramov N.N. Wasseraufbereitung, M.: Stroyizdat 1974
Frosch B.N. Levchenko A.P. Wasseraufbereitung, M.: Stroyizdat 1996
Um Wassergerüche zu beseitigen, die durch die Aktivität bestimmter Algen und Mikroorganismen entstehen, wird Wasserdesodorierung eingesetzt. Dazu gehören Arten der Wasseraufbereitung wie Chlorierung, Ozonierung, Ammoniakierung, Belüftung und Behandlung mit Kaliumpermangamat. Gerüche und Geschmäcker können eliminiert werden, indem Wasser durch eine Aktivkohleschicht in Druckfiltern gefiltert wird. Zu diesem Zweck werden Birken-, Torf- und Steinkohlen verwendet.
Aufgrund der Anwesenheit von Phenolen, die aus Industriebetrieben in die Quelle gelangen, entwickelt Wasser häufig einen unangenehmen Geruch und Geschmack. Wenn solches Wasser gechlort wird, verursacht der geringste Gehalt an Phenolen das Auftreten von Chlorphenolgerüchen. Daher versuchen sie, phenolhaltiges Wasser nicht zu chloren. Ein wirksames Mittel zur Bekämpfung dieser Gerüche ist die Ammoniakierung von Wasser, also die Einführung einer bestimmten Dosis Ammoniak in das Wasser.
Ammoniak
Ammoniak wird auch in Abwesenheit von Phenolen verwendet, um Chlorgerüche zu beseitigen, die bei der Wasserchlorierung entstehen. Die bakterizide Wirkung von Chlor nimmt ab, ihre Dauer nimmt jedoch zu. Der Kontakt von Wasser mit Chlor während der Ammoniierung muss mindestens 2 Stunden dauern. Ammoniak wird mit speziellen Geräten – Ammoniatoren – in das Wasser eingebracht.
Stoffe, die im Wasser Geruch und Geschmack verursachen, sind flüchtig. Daher trägt die Belüftung, die vor dem Einbringen von Chlor oder anderen Oxidationsmitteln in das Wasser durchgeführt wird, zur Reduzierung von Gerüchen und Geschmack bei. Das Wesen der Belüftung besteht darin, dass das zu behandelnde Wasser künstlich mit Luft gesättigt wird, um die darin enthaltenen organischen Substanzen zu oxidieren. Die aus dem Wasser freigesetzte Luft trägt die dort vorhandenen Gerüche und Geschmäcker mit sich.
Eine gute Wirkung der Wasserdesodorierung wird durch die Verwendung von Ozon und Kaliumpermanganat erzielt. Manchmal wird Kaliumpermanganat mit Aktivkohle verwendet.
Wasser kann einen bestimmten, nicht immer angenehmen Geruch haben, der durch die verschiedenen darin enthaltenen organischen Substanzen entsteht, die durch die lebenswichtige Aktivität oder den Zerfall von Mikroorganismen und Algen entstehen. Die Wasserreinigung von Gerüchen (Wasserdesodorierung) erfolgt unter Verwendung verschiedener Modifikationen der Methode der Wasserchlorierung, Sorptionsfiltration, Karbonisierung, Belüftung, Ozonierung, Wasseraufbereitung mit Kaliumpermanganat, Wasserstoffperoxid und einer Kombination dieser Methoden.
Wasseraufbereitung mit Aktivkohle
Wenn wir Sorptions- und oxidative Desodorierungsmethoden vergleichen, ist die erste zuverlässiger, da sie auf der Extraktion organischer Substanzen aus Wasser und nicht auf deren Umwandlung basiert. Die wirksamsten Sorptionsmittel sind Aktivkohlen, die Phenole, die meisten Erdölprodukte, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (einschließlich krebserregender), Chlor- und Organophosphor-Pestizide sowie andere organische Verunreinigungen gut absorbieren. Die Sorption an Aktivkohlen ist jedoch kein universelles Mittel zur Reinigung von Wasser aus organischen Verbindungen, da einige Stoffe (z. B. organische Amine) von ihnen nicht oder nur schlecht zurückgehalten werden (z. B. synthetische Tenside).
Aktivkohlen werden in Pulverform zur Karbonisierung von Wasser und in Granulatform als Beladung für Filter eingesetzt. Erwähnenswert sind eine Reihe von Nachteilen, die die Umsetzung der Karbonisierung von Wasser einschränken – dies sind die Schwierigkeiten beim Einweichen und Dosieren der Kohle, die Notwendigkeit eines Behälters, um den Kontakt der Kohle mit dem aufbereiteten Wasser sicherzustellen usw. Daher wird diese Methode verwendet vor allem, wenn gelegentlich eine kurzfristige Desodorierung kleiner Wassermengen erforderlich ist.
Zuverlässiger ist der Einsatz körniger Aktivkohlen als Filtermedium. Unabhängig von Schwankungen der Wasserverschmutzung stellen mit körniger Aktivkohle beladene Filter eine hervorragende Barriere gegen sorbierte Stoffe dar, bis die Kohlenstoffkapazität erschöpft ist.
Kohlefilter sind nach Klärfiltern angeordnet. Es ist auch möglich, kombinierte Klär- und Sorptionsfilter einzusetzen.
Der Nachteil von Kohlefiltern ist die Notwendigkeit, Aktivkohle zu regenerieren. Die Wiederherstellung der Kohlebeladung kann durch chemische, thermische und biologische Methoden erfolgen. Bei der chemischen Regenerationsmethode wird die Kohle zunächst mit Frischdampf und anschließend mit Alkali behandelt. Trotz aller Komplexität und Arbeitsintensität ist die Methode nicht effektiv genug, da die Sorptionskapazität des Materials nicht vollständig wiederhergestellt wird. Bei der thermischen Methode werden adsorbierte organische Verbindungen bei einer Temperatur von 800...900 °C in speziellen Öfen verbrannt. Diese recht aufwendige Regenerationsmethode geht mit Kohleverlusten bei der Feuerung einher. Die biologische Regenerationsmethode beruht auf der Fähigkeit von Bakterien, adsorbierte organische Kohlenstoffverbindungen zu mineralisieren, die Geschwindigkeit dieses Prozesses ist jedoch sehr gering.
In industriellen Wasseraufbereitungssystemen und insbesondere in Haushaltssystemen ist der Einsatz einer der oben genannten Regenerationsarten in der Regel nicht möglich, und wenn die Reinigungsqualität nachlässt, werden die Filtermedien einfach ausgetauscht.
Oxidationssorptionsverfahren zur Wasseraufbereitung
Aus diesem Grund ist die Aufgabe, die Regenerationszeit von körniger Aktivkohle zu verlängern, dringend erforderlich, was erfolgreich gelöst wird, indem Wasser mit einem Oxidationsmittel behandelt wird, bevor es durch die Kohle gefiltert wird. Eine solche Wasseraufbereitung führt nicht einfach zur Summierung zweier Prozesse, sondern trägt zur Manifestation der Wirkung der Oxidation-Sorption-Wechselwirkung bei. Gleichzeitig „funktioniert“ Kohle als Oxidationskatalysator, wodurch die Tiefe und Geschwindigkeit dieses Prozesses deutlich erhöht wird und gleichzeitig viele Oxidationsprodukte besser an der Kohle sorbiert werden. Durch die gleichzeitige Anwendung zweier Methoden wird der Bereich der aus dem Wasser entfernten organischen Verunreinigungen erheblich erweitert. Auch der wirtschaftliche Vorteil des kombinierten Einsatzes von Oxidationsmitteln und Aktivkohle hat sich in der Praxis bewährt.
Ausgangsdaten wie die Qualität des aufbereiteten Wassers, die Zusammensetzung und Art der Aufbereitungsanlagen bestimmen die Vielfalt der technischen Lösungen für den Einsatz der Oxidations-Sorption-Methode zur Wasserreinigung, beispielsweise mit körniger Aktivkohle beladene Filter, die Wasser reinigen ausschließlich aus organischen Verunreinigungen, liegen im technologischen Schema nach. Filter, die körnige Kohle verwenden und zusätzlich zu der angegebenen Funktion auch die Funktion der Wasserklärung übernehmen, werden nach den Strukturen der ersten Stufe platziert. Die Beladung solcher Filter besteht aus zwei Möglichkeiten: 1) besteht vollständig aus Aktivkohle; 2) besteht aus Kohle und mechanisch gereinigtem Material (Doppelschichtbeladung). 
Das Schema der Kontaktwasserklärung sieht auch die Möglichkeit vor, separate Kohlefilter nach den Kontaktklärbecken zu platzieren oder Kontaktklärbecken mit Sand-Kohle-Beladung zu installieren. Es ist erwähnenswert, dass im ersten Fall die Wasserfiltration nacheinander durch zwei separate Filterkaskaden erfolgt , kommt es zu einem deutlichen Anstieg der Kapitalkosten für den Bau von Aufbereitungsanlagen. In diesem Fall wird die Kohlenstofffracht jedoch bestimmungsgemäß (zur Entfernung chemischer Verunreinigungen) verwendet und befindet sich unter den günstigsten Bedingungen, da geklärtes Wasser zum Kohlenstofffilter fließt. Dadurch muss der Filter seltener gewaschen werden, was den Kohleverlust, das Schleifen und den Abrieb reduziert; Die Verringerung der Verstopfung der Kohleporen durch Suspension fördert eine bessere Sorption chemischer Verunreinigungen und erhöht die Lebensdauer von Kohle als Sorptionsmittel.
Sanitär-hygienische und technisch-ökonomische Indikatoren der Wasserreinigung und der Zweck der Kohleverladung bestimmen ihren Standort im technologischen Schema. In allen Fällen muss die Einführung eines Oxidationsmittels in das aufbereitete Wasser erfolgen, bevor es in die Kohleverladung gelangt .
Möglichkeiten zum Einbringen eines Oxidationsmittels in Wasser:
1) zu Beginn des technologischen Schemas;
3) direkt vor dem Kohlefilter;
4) doppelte Einführung von Oxidationsmitteln unterschiedlicher Art. Darüber hinaus wird der Ort, an dem das Oxidationsmittel eingeführt wird, durch die dem Oxidationsmittel zugewiesenen allgemeinen Aufgaben, die Geschwindigkeit seines Verbrauchs und andere Faktoren bestimmt.
 Bei unterirdischen Quellen wird in der Regel die erste Eingabemöglichkeit verwendet, bei oberirdischen Quellen die zweite. Bei der Verwendung der Oxidations-Sorption-Methode zur Wasserdesodorierung ist es wichtig, die Art des verwendeten Oxidationsmittels richtig auszuwählen. Derzeit vorhandene Oxidationsmittel, die in der Praxis der Wasseraufbereitung mit Reagenzien üblich sind, unterscheiden sich in ihrer Wirksamkeit (aus technischer, wirtschaftlicher sowie sanitärer und hygienischer Sicht) in Bezug auf chemische Wasserverunreinigungen.
Bei unterirdischen Quellen wird in der Regel die erste Eingabemöglichkeit verwendet, bei oberirdischen Quellen die zweite. Bei der Verwendung der Oxidations-Sorption-Methode zur Wasserdesodorierung ist es wichtig, die Art des verwendeten Oxidationsmittels richtig auszuwählen. Derzeit vorhandene Oxidationsmittel, die in der Praxis der Wasseraufbereitung mit Reagenzien üblich sind, unterscheiden sich in ihrer Wirksamkeit (aus technischer, wirtschaftlicher sowie sanitärer und hygienischer Sicht) in Bezug auf chemische Wasserverunreinigungen.
Bei relativ leicht oxidierbaren Schadstoffen im Wasser (Phenole, einige Stoffe natürlichen Ursprungs etc.) empfiehlt sich der Einsatz von Chlor als Oxidationsmittel. Darüber hinaus erfordern die Bedingungen für den kombinierten Einsatz von Chlor und Aktivkohle eine vorherige Ammoniakierung des Wassers - bei Bedarf erfolgt dies bei der Endchlorung.
Wenn Wasser überwiegend schwer oxidierbare Schadstoffe enthält (lösliche Anteile des Öls und seiner Produkte, synthetische Tenside, organische Pestizide usw.), empfiehlt sich der Einsatz von Ozon als stärkstem Oxidationsmittel. In manchen Fällen ist auch der Einsatz mehrerer Oxidationsmittel (Ozon und Chlor, Chlor und Kaliumpermanganat) wirksam. Durch Labortests werden das Oxidationsmittel, seine Dosis und der Ort seiner Einführung in das technologische Schema der Wasserreinigung ausgewählt – unter Berücksichtigung einer minimalen Belastung der Kohle als Sorptionsmittel. Dabei wird auch die Funktion der Kohle als Katalysator für den Oxidationsprozess berücksichtigt.
Ein sehr wichtiges Thema ist die Betriebszeit von Aktivkohle, die rechnerisch kaum zu ermitteln ist. Es hängt von der richtigen Auswahl der Art und Dosierung des Oxidationsmittels sowie einer Reihe anderer Bedingungen ab. Wie die Praxis zeigt, trägt die kombinierte Verwendung eines Oxidationsmittels und von Aktivkohle dazu bei, die Sorptionsaktivität von Kohle über einen längeren Zeitraum (in) aufrechtzuerhalten Übung kann es bis zu 2 Jahre dauern). Unter diesen Umständen ist die Regenerierung der Kohle nicht immer wirtschaftlich gerechtfertigt, insbesondere wenn man bedenkt, dass zum Ausgleich der Verluste durch Mahlen, Abrieb und Mitreißen beim Waschen jährlich frische Kohle hinzugefügt werden muss (ungefähr 10 % pro Jahr). Menge Kohle). Gleichzeitig ist aufgrund der Verschmutzung mit anorganischen Verunreinigungen (hauptsächlich Hydroxide von Eisen, Aluminium usw.) ein starker Rückgang der Sorptionskapazität der Kohle gegenüber organischen Stoffen möglich. Daher besteht die Aufgabe darin, einen hohen Grad der Vorklärung des Wassers (nämlich dessen Enteisenung und Entmanganung) sicherzustellen, bevor es in die Kohleverladeschichten gelangt. Dabei handelt es sich in erster Linie um Filteranlagen mit den kombinierten Funktionen Klärung und Reinigung von chemischen Verunreinigungen.
U Sehr geehrte Damen und Herren, wenn die Aufgabe der Implementierung eines Wasserdesodorierungssystems für Sie dringend ist, wenden Sie sich bitte an die Spezialisten des Unternehmens Wassermann. Wir bieten Ihnen die beste technologische Lösung.
Desodorierung von Wasser
Geschmäcker und Gerüche natürlicher Gewässer sind natürlichen und künstlichen Ursprungs, was den Unterschied in ihrer chemischen Zusammensetzung und die Vielfalt der Wasseraufbereitungsmethoden für ihre Lokalisierung bestimmt.
Zur Entfernung unerwünschter Geschmacks- und Geruchsstoffe aus dem Wasser werden Belüftung, Oxidation mit Chlor, Ozon, Kaliumpermanganat, Chlor und anderen Oxidationsmitteln eingesetzt; Sorption durch Aktivkohle.
Gerüche und Geschmäcker, die durch das Vorhandensein von Mikroorganismen im Wasser verursacht werden, können auch beseitigt werden, indem das Wasser in Druckfiltern durch eine Schicht aus Aktivkohlegranulat gefiltert wird oder indem dem Wasser vor dem Filtern in offenen Sandfiltern pulverförmige Kohle zugesetzt wird. Bei großen Dosen (mehr als 5 mg/l) sollte die Kohle an der Pumpstation des ersten Anstiegs oder gleichzeitig mit dem Koagulans in den Mischer eingebracht werden, jedoch nicht früher als 10 Minuten nach dem Einbringen von Chlor. Es wird empfohlen, Aktivkohle in Form einer Pulpe mit einer Konzentration von 5...10 % zu dosieren. Bei Kohledosierungen bis 1 mg/l ist eine Trockendosierung von Kohlepulver zulässig. Der Einsatz von Kohlepulver empfiehlt sich insbesondere dann, wenn regelmäßig Gerüche und Geschmäcker auftreten. Die Dosierung der Aktivkohle wird durch eine Probekarbonisierung bestimmt, deren Technik der Probechlorung ähnelt. Um die Sorptionskapazität der körnigen Aktivkohle wiederherzustellen, ist es notwendig, sie regelmäßig zu regenerieren, indem man sie mit einer heißen Lösung aus Alkali und Calciumhypochlorit wäscht oder sie in Öfen kalziniert.
Um Gerüche und Geschmäcker zu entfernen, werden am häufigsten Birken-BAU, Torf-TAU, Steinkohle KAD und AG-3-Kohlen verwendet. Pulverförmige Aktivkohle muss in einem feuerfesten, trockenen Raum in einem hermetisch verschlossenen Behälter gelagert werden, da sie explosiv und selbstentzündlich ist.
Durch die Anwesenheit von Phenolen, die mit dem Abwasser von Industriebetrieben in die Quelle gelangen, erhält Wasser einen unangenehmen Geruch und Geschmack. Wenn Wasser gechlort wird, verursacht der geringste Gehalt an Phenolen das Auftreten intensiver Chlorphenolgerüche, ein wirksames Mittel zur Bekämpfung ist die Ammoniakbildung des Wassers – das Einbringen von Ammoniak oder einer Lösung seiner Salze in das Wasser. Ammoniak wird nach der Chlorierung von Wasser eingeführt: Seine Dosis beträgt 10...25 % der zur Desinfektion von Wasser eingeführten Chlordosis. Ammoniak kann auch in Abwesenheit von Phenolen verwendet werden, um Chlorgerüche zu beseitigen. Die bakterielle Wirkung von Chlor nimmt ab, ihre Dauer nimmt jedoch zu. Der Kontakt von Wasser mit Chlor während der Ammoniierung muss mindestens 2 Stunden dauern. Ammoniak wird mithilfe von Ammoniatoren in das Wasser eingebracht – Geräte, die im Design Chlorspendern ähneln.
Aufgrund der Flüchtigkeit der meisten Substanzen, die Geschmack und Geruch verursachen, ist die Belüftung von Wasser die einfachste und kostengünstigste Möglichkeit, es zu desodorieren. Die Belüftung erfolgt vor dem Einbringen von Chlor oder anderen Oxidationsmitteln in das Wasser.
Eine gute Wirkung der Wasserdesodorierung wird durch die Verwendung von Ozon und Kaliumpermanganat erreicht, letzteres wird manchmal in Kombination mit Aktivkohle verwendet.
Wasserenthärtung
Unter Wasserenthärtung versteht man die nahezu vollständige Eliminierung oder Reduzierung der darin enthaltenen Härtesalze. Gemäß den geltenden Normen und Vorschriften muss Wasser für Haushalts- und Trinkzwecke enthärtet werden, wenn seine Härte 7 mg Äq/l und in besonderen Fällen 14,7 mg Äq/l übersteigt. In einigen Industriezweigen (z. B. Textil-, Papierindustrie usw.), in denen eine Wasserhärte von nicht mehr als 0,7 bis 1,07 mg eq/l erforderlich ist, in Wäschereien und vor allem bei der Aufbereitung von Speisewasser für Kesselanlagen ist eine Wasserenthärtung erforderlich.
Die Wasserenthärtung wird durchgeführt:
- – Ausfällung von Härtesalzen mit Reagenzien. Als Reagenzien kann entweder nur Kalk verwendet werden (die Methode heißt Kalken oder Dekarbonisierung), oder zusammen Kalk und Soda (die Methode heißt Limettensoda)
- – Filterung von Wasser durch eine Materialschicht, den sogenannten Kationenaustauscher (Kationit Weg).
Eines der drängenden Probleme der letzten Jahrzehnte im Bereich der Wasseraufbereitung ist die Notwendigkeit, Trinkwasser zu desodorieren. Die Verschlechterung der Geschmackseigenschaften natürlicher Wässer ist auf ihre mineralische und organische Zusammensetzung zurückzuführen. Unerwünschte Geschmäcker und Gerüche werden durch anorganische Verbindungen und organische Stoffe natürlichen und künstlichen Ursprungs verursacht.
Das Vorhandensein gelöster organischer Substanzen biologischen Ursprungs in natürlichen Gewässern ist das Ergebnis von Zersetzungsprozessen und anschließender Umwandlung abgestorbener höherer Wasserpflanzen, planktonischer und benthischer Organismen, verschiedener Bakterien und Pilze. Gleichzeitig werden große Mengen niedermolekularer Alkohole, Carbonsäuren, Hydroxysäuren, Ketone, Aldehyde und phenolhaltige Substanzen mit starkem Geruch in das Wasser abgegeben.
Organische Substanzen tragen zur Entwicklung von Mikroorganismen bei, die Schwefelwasserstoff, Ammoniak, organische Sulfide und übelriechende Mercaptane an die äußere Umgebung abgeben. Die intensive Entwicklung und das Absterben von Algen trägt zum Auftreten von Polysacchariden im Wasser bei; Oxal-, Wein- und Zitronensäure; Substanzen wie Phytonzide. In den Abbauprodukten von Algen liegt der Phenolgehalt 20-30 mal höher als die maximal zulässige Konzentration (0,001 mg/l).
Trotz der ergriffenen gesetzgeberischen Maßnahmen gelangen Industrieabwässer immer noch in Oberflächengewässer, was zu deren Verunreinigung mit mineralischen und organischen Verbindungen führt. Darunter sind Salze von Schwermetallen, Öl und Erdölprodukten, synthetische aliphatische Alkohole, Polyphenole, Säuren, Pestizide, Tenside usw.
Besonders gefährlich sind Pestizide, die zu verschiedenen Klassen organischer Verbindungen gehören und in den Gewässern verschiedener Bundesstaaten vorkommen. Sie wirken sich negativ auf die organoleptischen Eigenschaften von Wasser aus. Die Toxizität der im Wasser vorhandenen Pestizide nimmt zu, wenn es mit Chlor oder Kaliumpermanganat behandelt wird.
Öl und Erdölprodukte sind in Wasser schlecht löslich und sehr resistent gegen biochemische Oxidation. Große Ölkonzentrationen verleihen dem Wasser einen starken Geruch, erhöhen seine Farbe und Oxidationsfähigkeit und verringern den Gehalt an gelöstem Sauerstoff. Bei einem geringen Ölgehalt im Wasser verschlechtern sich seine organoleptischen Eigenschaften merklich.
Wenn Tenside mit Haushalts- und Industrieabwässern ins Wasser gelangen, verschlechtern sie dessen Qualität erheblich und verursachen anhaltende Gerüche (Seife, Kerosin, Kolophonium) und bitteren Geschmack. Tenside erhöhen in der Regel die Geruchsstabilität anderer Verunreinigungen, katalysieren die Toxizität krebserregender Stoffe, Pestizide, Anilin etc. im Wasser.
Huminsäuren und Fulvosäuren, Lignine und viele andere organische Verbindungen natürlichen Ursprungs, die in den natürlichen Gewässern Nord- und Zentralrusslands vorkommen, dienen als eine der Quellen für die Bildung von Phenolen, die ihre organoleptischen Eigenschaften verschlechtern. Bei der Chlorierung von phenolhaltigem Wasser entstehen Dioxine – äußerst giftige Substanzen (tödliche Dosen: Strychnin 1,5-10~6; Botulin - 3,3-10-17, Nervengas - 1,6·10~5 mol/kg). Eine Dioxindosis - 3,1-10~ 9 - ist tödlich, und eine Dosis von 6,5-10~ 15 mol/kg für Menschen unter 70 Jahren - das Krebsrisiko. Eine hundertmal geringere Dosis wirkt sich auf das Immunsystem aus System („chemische AIDS“) und Fortpflanzungsfunktionen des Körpers. Die giftigste Substanz ist 2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin (TCDD). Die wichtigste giftige Substanz in Emissionen aus Zellstoff- und Papierfabriken sind polychlorierte Dibenzofurane (PCDF) und Das stärkste Karzinogen – Verbrennungsprodukte von Heizöl, Benzin, Kohle usw. – ist Benzo(a)pyren (Synergie manifestiert sich im Dioxin-Benzo(a)pyren-Paar).
Die Herstellung des Pestizids 2,4-Dichlorphenol durch Chlorierung von Phenol geht mit der Bildung von 2,4,6-Trichlorphenol einher, das selbst zu Dioxinen kondensiert, die den Menschen mit Trinkwasser erreichen, da moderne Wasseraufbereitungstechnologien keine Barriere aufweisen Funktionen gegen Letzteres. Es wurde festgestellt, dass polychloriertes Dibenzo-i-dioxin (PCDD) und polychloriertes Dibenzfuran (PCDF) direkt bei der Chlorierung von Wasser entstehen, d. h. die Bildung von Dixinen bei der Vorchlorierung von Wasser ist unvermeidlich.
Das im Wasser enthaltene Eisen ist ein Katalysator für die zusätzliche Chlorierung von Phenolen und wandelt bei der Wasserchlorierung geringtoxische Dioxine in hochgiftige um. Die im Wasser enthaltenen organischen Substanzen passieren die Beladung der Schnellfilter nahezu ungehindert, einschließlich ihres giftigen dioxinhaltigen Anteils.
Manchmal verschlechtern sich die organoleptischen Eigenschaften von Wasser aufgrund einer Überdosierung von Reagenzien oder aufgrund eines unsachgemäßen Betriebs von Wasseraufbereitungsanlagen. Wenn sich Wasser durch Koagulation ohne anschließende Stabilisierung verfärbt, nimmt die korrosive Aktivität des Wassers zu und infolgedessen verschlechtern sich seine organoleptischen Eigenschaften. Bei der Chlorierung von Wasser kommt es sowohl bei Verstößen gegen das Prozessregime als auch durch die Bildung chlororganischer Verbindungen, die unangenehme Geschmäcker und Gerüche verursachen, zu einer Verschlechterung seiner organoleptischen Eigenschaften.
Es wurde festgestellt, dass herkömmliche Methoden der Wasserreinigung eine schwache Barrierewirkung haben, vor allem gegenüber den im Wasser vorkommenden chemischen Verunreinigungen. Wasser in Form von Suspensionen und Kolloiden oder werden bei der Reinigung und Vorbehandlung mit Chlor unlöslich (z. B. emulgierte Erdölfraktionen, schwerlösliche Pestizide, einige Metalle). In Bezug auf solche Verunreinigungen kann die Barrierefunktion von Aufbereitungsanlagen durch die entsprechende Auswahl von Reagenzien für einen hohen Grad der Wasserklärung erhöht werden.
Die Desodorierung von Wasser wird in einigen Fällen durch Koagulation und Ausflockung von Verunreinigungen und anschließende Filtration erreicht. Oft ist jedoch der Einsatz spezieller Technologien erforderlich, um unerwünschte Gerüche und Geschmäcker zu beseitigen. Ihre Wahl wird durch die Art der Verunreinigungen und den Zustand, in dem sie sich befinden (Suspensionen, Kolloide, echte Lösungen, Gase), bestimmt.
Heutzutage gibt es keine universellen Methoden zur Wasserdesodorierung; die Kombination einiger davon sorgt jedoch für den erforderlichen Reinigungsgrad. Wenn Substanzen, die unangenehme Geschmäcker und Gerüche verursachen, in einem suspendierten und kolloidalen Zustand vorliegen, führt ihre Koagulation zu guten Ergebnissen. Geschmacks- und Geruchsstoffe, die durch gelöste anorganische Stoffe entstehen, werden durch Entgasung, Enteisenung und Entsalzung entfernt. usw. Gerüche und Geschmäcker, die durch organische Substanzen verursacht werden, sind sehr hartnäckig. Sie werden normalerweise entfernt< путем оксидации и сорбции.
Stoffe mit stark reduzierenden Eigenschaften (Huminsäuren, Eisen(II)-Salze, Tannine aus festen Abfällen, Schwefelwasserstoff, Nitrite, mehr- und einwertige Phenole usw.) lassen sich durch Oxidation leicht aus Wasser extrahieren. Stabilere Verbindungen (Carbonsäuren, aliphatische Alkohole, Erdölkohlenwasserstoffe und Erdölprodukte usw.) werden bei Behandlung mit Chlor und seinen Derivaten und manchmal sogar Ozon schlecht oxidiert. Manchmal verstärken starke Oxidationsmittel, die auf diese Substanzen einwirken, den ursprünglichen Geschmack und Geruch erheblich (z. B. Organophosphat-Pestizide). Gleichzeitig führt die Einwirkung von Oxidationsmitteln auf leicht oxidierbare Verbindungen zu deren vollständiger Zerstörung oder zur Bildung von Stoffen, die die organoleptischen Eigenschaften des Wassers nicht beeinträchtigen. Daher ist die Wirkung von Oxidationsmitteln nur gegen eine begrenzte Anzahl von Verunreinigungen wirksam.
Der Nachteil der oxidativen Methode besteht auch darin, dass das Oxidationsmittel sehr genau entsprechend dem Grad und der Art der Wasserverschmutzung dosiert werden muss, was angesichts der Komplexität und Dauer vieler chemischer Analysen äußerst schwierig ist.
Zuverlässiger und wirtschaftlicher ist der Einsatz von Filtern mit körniger Aktivkohle als Filtermedium. Mit körniger Aktivkohle beladene Filter stellen unabhängig von Schwankungen der Wasserverschmutzung eine dauerhafte Barriere gegen sorbierte Stoffe dar. Eine große Schwierigkeit bei der Anwendung dieser Methode der Wasserreinigung ist jedoch die relativ geringe Absorptionsfähigkeit der Kohle, die einen häufigen Austausch oder eine Regeneration erforderlich macht.
Darüber hinaus wurde festgestellt, dass hydrophobe Substanzen durch Aktivkohle gut aus Wasser sorbiert werden, d. h. darin schlecht löslich sind und in Lösungen schlecht hydratisiert werden (schwache organische Elektrolyte, Phenole usw.). Stärkere organische Elektrolyte und viele organische azyklische Verbindungen (Carbonsäuren, Aldehyde, Ketone, Alkohole) werden von Aktivkohle weniger effektiv sorbiert.
Bei erhöhter anthropogener Verschmutzung von Gewässern ist es notwendig, Methoden der Oxidation, Sorption und Belüftung zu kombinieren, um Wasser zu desodorieren und giftige Mikroschadstoffe zu entfernen.
Wasserdesodorierung durch Belüftung
Um flüchtige organische Verbindungen biologischen Ursprungs, die Gerüche und Geschmack verursachen, aus natürlichen Gewässern zu entfernen, wird häufig Belüftung eingesetzt.
In der Praxis erfolgt die Belüftung in speziellen Anlagen – Sprudel-, Sprüh- und Kaskadenbelüftern.
Bei Sprudelbelüftern wird die von Gebläsen zugeführte Luft durch im Tank aufgehängte perforierte Rohre (Abb. 15.1) und am Boden befindliche Sprühvorrichtungen im Wasser verteilt. Der Vorteil der ersten Methode ist die einfache Demontage der Anlage.
Die Luftverteilung durch Zerstäubungsgeräte wird häufig bei Spiralwasserbelüftern eingesetzt, die in Großanlagen eingesetzt werden.
Die Tiefe der Wasserschicht in Belüftern dieses Typs liegt zwischen 2,7 und 4,5 m. Untersuchungen zeigen, dass die Höhe der Wasserschicht während des Sprudelns sofort erreicht wird, da das Gleichgewicht zwischen den Konzentrationen der geruchstragenden Substanzen in der flüssigen und gasförmigen Phase erreicht wird spielt keine wesentliche Rolle und kann auf 1-1,5 m reduziert werden. Die maximale Breite des Beckens beträgt in der Regel das Doppelte der Tiefe. Quadrat
Reis. 15.1. Blasenbelüfter (a) und Inkabelüfter (b)
6 - Hauptluftkanal; 2 – Wassereinlass in die Sprudelkammer 5; 3 - Lochplatten; 4 - Luftverteiler; 7.1 - Ableitung von belüftetem Wasser und Zufuhr von Quellwasser; 8 - Überlauf; 9 - stabilisierte Trennwand; 10 - Schaumschicht; 11 - Ventilator; 12 - perforierter Boden; b – Die Oberflächenblasenkammer wird willkürlich gewählt. Die Dauer des Luftblasens beträgt in der Regel nicht mehr als 15 Minuten. Der Luftverbrauch beträgt 0,37–0,75 m 3 /min pro 1 m 3 Wasser.
Offene Sprudelanlagen können bei Temperaturen unter 0 °C betrieben werden. Der Belüftungsgrad lässt sich einfach durch Veränderung der zugeführten Luftmenge einstellen. Der Aufwand für Installationen und deren Betrieb ist gering.
Bei Sprühbelüftern wird Wasser durch Düsen in kleine Tröpfchen zerstäubt und dadurch die Kontaktfläche zur Luft vergrößert. Der Hauptfaktor für den Betrieb des Belüfters ist die Form der Düse und ihre Abmessungen. Die Kontaktdauer von Wasser mit Luft, bestimmt durch die Anfangsgeschwindigkeit des Strahls und seine Flugbahn, beträgt üblicherweise 2 s“ (für einen vertikalen Strahl, der unter einem Druck von 6 m ausgestoßen wird).
Bei Kaskadenbelüftern fällt das behandelte Wasser in Strahlen durch mehrere hintereinander angeordnete Wehre. Die Kontaktdauer kann bei diesen Belüftern durch Erhöhung der Stufenzahl verändert werden. Der Druckverlust bei Kaskadenbelüftern liegt zwischen 0,9 und 3 m.
Bei Mischbelüftern wird Wasser gleichzeitig versprüht und fließt in einem dünnen Strahl von einer Stufe zur anderen. Um die Kontaktfläche zwischen Wasser und Luft zu vergrößern, werden Keramikkugeln oder Koks verwendet.
Ein häufiger Nachteil von Belüftern, die auf dem Prinzip des Kontakts eines Wasserfilms mit Luft basieren, ist ihre Unwirtschaftlichkeit aufgrund ihrer großen Fläche, die Unmöglichkeit, sie im Winter zu verwenden, die Notwendigkeit einer starken Belüftung bei der Installation in Innenräumen und schließlich ihre Neigung zur Verschmutzung.
Die Belüftung des Wassers in der Schaumschicht erfolgt in einem Inka-Belüfter (Abb. 15.1.6), einem Betontank, an dessen Boden sich eine perforierte Edelstahlplatte befindet. Das Wasser wird durch ein Verteilerrohr gleichmäßig über die Platte verteilt. Zur Stabilisierung der Schaumstoffschicht kommt ein spezielles Prallblech zum Einsatz. Das Wasser wird mit Luft belüftet, die von einem Ventilator zugeführt wird. Nachdem das Wasser den Tintenbelüfter passiert hat, wird es über den Überlauf abgeführt.
Die Ausbildung einer riesigen Grenzfläche zwischen flüssiger und gasförmiger Phase sorgt für eine hohe Intensität des Desodorierungsprozesses. Das normale Luft-Wasser-Verhältnis in Farbbelüftern liegt zwischen 30:1 und 300:1. Trotz des hohen Luftverbrauchs ist eine intensive Belüftung wirtschaftlich sinnvoll (aufgrund des geringen Druckverlustes erfolgt die Luftzufuhr über einen Ventilator).
Durch die Belüftung können jedoch anhaltende Gerüche und Geschmäcker nicht beseitigt werden, die durch das Vorhandensein von Verunreinigungen mit unbedeutender Flüchtigkeit verursacht werden.
Liste der verwendeten Arbeiten
Cherkinsky S.N. Sanitäre Bedingungen für die Ableitung von Abwasser in Stauseen, M.: Stroyizdat, Abramov N.N. Wasseraufbereitung, M.: Stroyizdat 1974